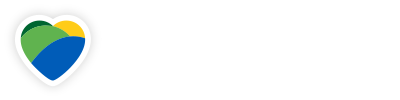Die jahrtausendelangen Beziehungen zwischen Sachsen und Böhmen sind das Thema einer neuen Ausstellung im Staatlichen Museum für Archäologie in Chemnitz. Die Schau vereint rund 450 Objekte zur Kulturgeschichte beider Regionen. Unsere Bildergalerie zeigt eine Auswahl.
- Mehr Lesekomfort auch für unterwegs
- E-Paper und News in einer App
- Push-Nachrichten über den Tag hinweg