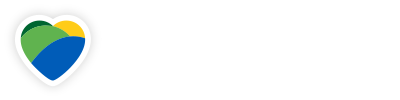Sie können sich Ihre Nachrichten jetzt auch vorlesen lassen. Klicken Sie dazu einfach auf das Play-Symbol in einem beliebigen Artikel oder fügen Sie den Beitrag über das Plus-Symbol Ihrer persönlichen Wiedergabeliste hinzu und hören Sie ihn später an.
Wird "Im Westen nichts Neues" der nächste oscar-gekrönte deutsche Film?
-
Der österreichische Schauspieler Felix Kammerer als Jungsoldat Paul in einer Szene des Films "Im Westen nichts Neues". Die deutsche Netflix-Produktion könnte am Sonntag zu den großen Gewinnern bei der Oscar-Verleihung gehören. Bild: Netflix/PA Media

Sie können sich Ihre Nachrichten jetzt auch vorlesen lassen. Klicken Sie dazu einfach auf das Play-Symbol in einem beliebigen Artikel oder fügen Sie den Beitrag über das Plus-Symbol Ihrer persönlichen Wiedergabeliste hinzu und hören Sie ihn später an.
Was Edward Bergers Remarque-Verfilmung so besonders macht und warum er deshalb am Sonntag gute Chancen auf mehrere Academy Awards hat.
Registrieren und testen.