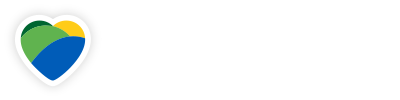Auslöser des Grubenunglücks in Zwickau ist bis heute nicht restlos geklärt
Zwickau. Am Rosenmontag im Februar 1960 fährt der Pendel-Bus wie immer. Tag für Tag führt die Route zum "Karl-Marx"-Werk jener Stadt, in der seit 1957 auch der legendäre "Trabi" gefertigt wird. Männer aller Jahrgänge sind unter jenen, die an diesem Mittag wie gewöhnlich unter Tage wollen. Männer, die wie der 20-jährige Thomas Klemm die Steinkohle nach oben holen. Und doch ist etwas anders an diesem 22. Februar, an dem die Kumpel zur Mittagsschicht wollen. "Schon an der Bushaltestelle wurde erzählt, dass es ein Unglück gegeben haben soll", erinnert sich Klemm. Die Stimmung ist gedrückt, niemand weiß etwas Genaues. Dass gerade eine Katastrophe passiert ist - all das können die Mittagsschichtler in ihrer Tragweite nicht erfassen. Erst als sie am Schacht ankommen, die Gruben- und Feuerwehr, die Krankenwagen sehen, erahnen sie das Ausmaß. Es ist ein Grubenunglück, das mit 123 Toten das schwerste in der Geschichte der DDR werden sollte.
174 Bergleute waren an jenem Morgen um sechs Uhr eingefahren. Die Handwerker in der Grube als letzte. Der 20-jährige Elektriker Rainer Leistner ist einer von ihnen, einer aus der 24 Mann starken Elektrobrigade. Auch für ihn, so scheint es zunächst, wird es eine Routineschicht werden. Wie üblich empfängt er seinen Arbeitsauftrag, fährt über den Blindschacht 8 ein. Dann macht er sich auf den Weg. Sein Ziel und das der drei Kollegen seiner unmittelbaren Abteilung ist die Mittelsohle am Blindschacht 32. Die Uhr zeigt 8.20 Uhr, als es "zweimal jämmerlich knallt". Es gibt einen unheimlichen Luftdruck, das Licht geht aus, Staub in großen Mengen liegt in der Luft. "Und dann gab es eine unheimliche Ruhe - alles stand ja plötzlich", sagt Leistner. Es ist diese bedrohliche Ruhe, die er nie vergessen wird.
Aber es ist auch der Augenblick, der im Berg über Leben und Tod entscheidet. Ruhe bewahren, das ist jetzt wichtig. Ohnehin haben nur die eine Chance, die möglichst weit weg sind vom Unglücksherd, was immer an dieser Stelle auch passiert sein mag. Der Reviersteiger schickt die Männer los zum Schacht 32. Dort aber müssen sie feststellen, dass die Leitern fehlen. So geht es zurück in der Hoffnung, 1000 Meter unter Tage einen anderen Fluchtweg zu finden. "Aber jetzt begann der Tumult, weil alle furchtbare Angst hatten", erinnert sich Leistner. Er ist einer der Letzten, der sich auf den Weg macht, denn zuvor gibt es ein Gerangel um die "Selbstretter": Atemfilter, die das tödliche Kohlenmonoxid binden und nur den Sauerstoff zur Atmung durchlassen. Bei dieser chemischen Reaktion werden die Filter so heiß, dass man sie nicht mehr anfassen kann. "Man dörrt aus in der Kehle, das ist unglaublich schmerzhaft", weiß der Bergmann. "Aber mir war eins klar: Wenn ich den absetze, war es das..." Leistner schafft es irgendwie und unter Schmerzen, den "Selbstretter" nicht abzunehmen.
Aber wohin? Wohin muss er gehen? Er geht als Einziger hinunter in Richtung "Frischwettern", "so wie es uns immer wieder eingebläut worden ist". Möglicherweise rettet ihm das sein Leben. "Dann fand ich ein Seil von der Seilbahn." Und dieses Stück Seil setzt noch einmal sämtliche Überlebenskräfte frei. Er irrt also weiter: nun durch das erste Feuer an brennenden Stößen vorbei, dort, wo die Kohle abgefüllt worden war. Und dorthin, wo die Luft etwas frischer wird. Er geht weiter und stößt auf die zweite helle Feuerwand. "Da bin ich wieder durch", so Leistner. Dahinter hört er Stimmen - und ahnt: Er könnte es schaffen. "Ganz links unten, ganz links unten", schreien Männer immer wieder. Er soll nicht unmittelbar am Feuer vorbei. Was er erst später erfahren wird: Die anderen drei Kollegen aus seiner unmittelbaren Abteilung schaffen es nicht. Sie gehören zu den 123 Opfern dieses Tages.
Es ist schwer zu sagen, wie lange der Kampf von Leistner dauert. Noch gibt es keine Beförderungsmöglichkeiten hier unten. Mehr als 800 Meter muss er laufen, bis er den Blindschacht erreicht hat, wo er auf dem Beifahrersitz einer Lok Platz findet und zur Werkstatt fährt. Es ist elf, vielleicht zwölf Uhr mittags, als er wieder den Himmel sieht. Reinhard Leistner kommt zunächst in die Sanitätsstelle, wo er Sauerstoff in großen Mengen inhaliert.
Rings um "Karl Marx" ist seit dem Beginn der Tragödie eine beispiellose Rettungsaktion angelaufen. Sie wird noch Tage andauern. Aus allen Revieren der DDR und aus der benachbarten CSSR sind Grubenwehren vor Ort - rund 500 Mann versuchen rund um die Uhr, Bergmann um Bergmann zu retten. Am Ende werden es keine 50 schaffen, der brennenden Hölle zu entfliehen.
Auch die Bergleute und Grubenwehren aus dem Ruhrpott bieten ihre Hilfe an. Aber der Kalte Krieg zwischen Ost und West läuft längst auf Hochtouren. Zwar ordnet auch die Bundesregierung Staatstrauer an, doch die DDR lehnt Unterstützung ab und weist sie als "Heuchelei" zurück. Derweil wird auch in den westdeutschen Blättern gegen den Planerfüllungsdruck in der "Sowjetzone" geätzt. So ist die Rettung von Anfang an durch einen politischen Schlagabtausch zwischen Ost und West überschattet. Zwei Tage nach der Tragödie macht sich DDR-Ministerpräsident Otto Grotewohl auf den Weg nach Sachsen, wo er die überlebenden Bergleute am Krankenbett besucht. Auch Adolf Hennecke, der Vorzeigebergmann und Bestarbeiter, spricht zu den Bergleuten. Eine knappe Woche kämpfen die Helfer verzweifelt um die Kumpel. Zwar gelingt es, noch einige Bergleute zu retten. Doch als sich nach sechs Tagen ein neuer gewaltiger Brandherd unter Tage bildet, fällt letztlich die Entscheidung. Die Einsatzleitung beschließt, den Abschnitt zuzumauern. 123 Tote.
Die DDR ist unter Druck. Sie bildet eine hochkarätig besetzte Expertenkommission, die die Ursache ermitteln soll. Im Schatten dieser arbeitet eine weitere Untersuchungskommission: Die Staatssicherheit, die bei schweren Straftaten oder Unglücken automatisch Ermittlungen übernimmt, zieht Bergleute, Gerichtsmediziner, Wissenschaftler zurate, um in monatelanger Kleinstarbeit die Antwort auf eine Frage zu beantworten: Was war der Auslöser des Infernos? Die Frage ist bis heute nicht restlos beantwortet, und in Zwickau wird schon seit 50 Jahren um diesen sensiblen Punkt spekuliert und auch gestritten. "Noch leben hier ja viele Hinterbliebene", sagt die Leiterin des Zwickauer Stadtarchivs, Silva Teichert. Die These von der Sabotage wird bereits 1960 von allen Ermittlern zügig wieder verworfen, nichts spricht dafür. Schnell macht dagegen das Gerücht die Runde, dass eine Sprengstoffexplosion der Auslöser gewesen sein könnte. Dafür sprechen auch die zerfetzten Leichen, die ein Jahr nach dem Unglück gefunden werden, als in Gegenwart der Geheimdienstler und im Zuge der Ermittlungen der zugemauerte Abschnitt unter Tage noch einmal geöffnet wird.
Die Bilder erhärten den Schluss, dass eine Sprengstoffexplosion die folgende Kohlenstaubexplosion ausgelöst hat. Was tatsächlich der Auslöser war, bleibt bis heute offen. Die einen sprechen von der Möglichkeit eines Suizids, die anderen von grober Fahrlässigkeit eines Hauers. Ein Elektroschaden, mutmaßen Dritte wiederum, hat zu einer Methangasexplosion geführt. Von einem "Kantenschuss" als Auslöser wollen welche wissen. Das wäre die Variante einer Sprengpatrone, die nicht das vorgesehene Einschussloch getroffen hat. Auch der Abschlussbericht aus dem Sommer 1962 gibt keine endgültige Antwort auf die heikle Frage. Und selbst die Stasi-Akten sagen nichts restlos Verbindliches dazu.
So aufwändig wie die Ermittlungen geführt werden, so aufwändig war auch die Versorgung der Hinterbliebenen. Jeder Familie, der der Vater fehlt, wird für die nächsten Jahre ein staatlicher Betreuer zugeteilt. Er darf sich von nun an kümmern: um die kleinen und großen Probleme des Alltags, um Studiendelegierungen für die Kinder und Arbeitsplätze für die Witwen. "Das Ganze funktionierte natürlich nur, solange man sich ins System integrierte", weiß Bergmann Thomas Klemm.
Am wenigsten Hilfe erfahren die Überlebenden der Katastrophe. Leistner wird nach seiner Behandlung im Krankenhaus zur Kur geschickt. "Nie wieder, nie wieder" will er runterfahren, so traumatisiert, wie er ist. Aber was soll er tun? Vier Wochen darf er ins sächsische Bad Elster zur Rekonvaleszenz, es ist eine Art Erholungskur. Die Brandwunden sollen verheilen, die versengten Haare nachwachsen. Reichlich 500 Mark erhält er als Schmerzensgeld. "Das war mir aber eigentlich egal. Hauptsache, ich habe überlebt. Und ich bin gesund", so der heute 70-Jährige. Es gibt etliche, die - vom Kohlenmonoxid angegriffen - Hirnschäden davontrugen. Aber dann sind da die Kollegen, die Kumpels, die vielen Gespräche. Man kann nicht vergessen, was man vergessen will. Rainer Leistner sieht diese Bilder noch heute vor sich. Keine vier Monate dauerte es, bis er wieder einfuhr. Einmal Bergmann, immer Bergmann.
Dokumente zum Grubenunglück vor 50 Jahren
- Mehr Lesekomfort auch für unterwegs
- E-Paper und News in einer App
- Push-Nachrichten über den Tag hinweg