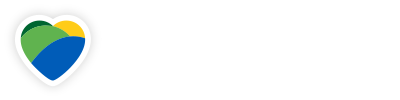Sie können sich Ihre Nachrichten jetzt auch vorlesen lassen. Klicken Sie dazu einfach auf das Play-Symbol in einem beliebigen Artikel oder fügen Sie den Beitrag über das Plus-Symbol Ihrer persönlichen Wiedergabeliste hinzu und hören Sie ihn später an.
Weltkrebstag: "Meine Familie hat das Brustkrebs-Gen"
-
Der Stammbaum gibt Aufschluss über das familiäre Krebsrisiko. Genetikerin Evelin Schröck und Gynäkologin Pauline Wimberger vom Uniklinikum Dresden beraten die Patientin Katrin Uhlworm über weitere Schritte. Bild: kairospress

Sie können sich Ihre Nachrichten jetzt auch vorlesen lassen. Klicken Sie dazu einfach auf das Play-Symbol in einem beliebigen Artikel oder fügen Sie den Beitrag über das Plus-Symbol Ihrer persönlichen Wiedergabeliste hinzu und hören Sie ihn später an.
Etwa jede zehnte Krebskrankheit ist erblich bedingt. Ein Gentest gibt Aufschluss - wie bei Katrin Uhlworm aus Dresden. Doch zu wenige haben Anspruch darauf, kritisieren Onkologen anlässlich des Weltkrebstages.
Registrieren und testen.