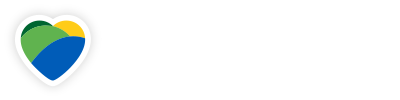Sie können sich Ihre Nachrichten jetzt auch vorlesen lassen. Klicken Sie dazu einfach auf das Play-Symbol in einem beliebigen Artikel oder fügen Sie den Beitrag über das Plus-Symbol Ihrer persönlichen Wiedergabeliste hinzu und hören Sie ihn später an.
Demenz: Universität Halle und Auer Pflegedienst forschen gemeinsam
-
Demenz Illustration Bild: Jens Büttner/dpa/Archiv

Sie können sich Ihre Nachrichten jetzt auch vorlesen lassen. Klicken Sie dazu einfach auf das Play-Symbol in einem beliebigen Artikel oder fügen Sie den Beitrag über das Plus-Symbol Ihrer persönlichen Wiedergabeliste hinzu und hören Sie ihn später an.
Wissenschaftler aus Halle und Mitarbeiter des ambulanten Pflegedienstes Zion aus Aue gehen der Demenz, einer tückischen Krankheit, auf den Grund. Von der Suche nach Möglichkeiten, wie Betroffene möglichst lange selbstbestimmt leben können.
Registrieren und testen.