Im November 1989 öffnete sich die "Freie Presse" oppositionellen Parteien und Organisationen, stellte wöchentlich - später fast täglich - Seiten zur Verfügung, die von den neuen politischen Akteuren gefüllt wurden.
Im Winter 1989/90 dürften sich viele Leserinnen und Leser die Augen gerieben haben, als sie morgens ihre "Freie Presse" aufschlugen. Da plauderte etwa am 3. Februar 1990 ein Informant des Ministeriums der Staatssicherheit aus dem Nähkästchen: "Ich war acht Jahr lang bei der Kirche tätig, hier lag meine Hauptaufgabe. Das MfS wollte von mir Infos über kirchliche Veranstaltungen und kirchliche Mitarbeiter haben. Man interessierte sich zum Beispiel, was die Leute für Laster haben: Alkoholprobleme, sexuelle Fehltritte, wie die Ehe ging und so weiter ..." Und: Ja, er sei für seine Informationen bezahlt worden, "aber reich werden konnte man davon nicht. Mal gab's 200 Mark, mal weniger. Meistens bekam ich irgendwelche Waren, wie beispielsweise ein Kaffeeservice, eine erzgebirgische Pyramide und so weiter. Auch die Kirchensteuer wurde für mich bezahlt."
Ein paar Tage später wird auf einen ehemaligen Bezirksstaatsanwalt, der offenbar an der Vertuschung eines staatlich organisierten Kunstraubs in der DDR beteiligt war, verwiesen, der nun als Mitglied eines "Untersuchungsausschusses zur Aufdeckung von Amtsmissbrauch und Korruption im Bezirk Karl-Marx-Stadt wieder auftauchte. Wieder einige Tage später wird in einem Beitrag auf die "Trostlosigkeit" des Fritz-Heckert-Wohngebietes hingewiesen, "völlig unterentwickelte Infrastruktur, widersinnige Straßenführung mitten durch die Wohngebiete, ... Schmutz und Unrat, überfüllte Schulen, ... Zerstörte Fußgängertunnel, Telefonzellen, Fahrstühle und so weiter sind Ausdruck der hohen Aggressivität unter Kindern und Jugendlichen."
Woraufhin sich einige Tage später aber Kritik aus dem Wohngebiet meldete. Dann wird der gesellschaftswissenschaftlichen Sektion der Technischen Universität Karl-Marx-Stadt vorgehalten, dass sie möglichst viele "Stalinisten" in die neue Zeit "hinüberretten" will und immer noch ein Geschichtsbild wie "zu Honeckers Zeiten" pflege.
Das waren ungewohnte Töne - selbst in der sich langsam selbst aus den Fängen der SED befreienden Zeitung, deren "Organ" sie vier Jahrzehnte lang war. Und diese Texte waren auch mit einem Zusatz versehen, der sie von den Beiträgen der übrigen Zeitung unterschied: "Verlag und Redaktion der 'freien presse' übernehmen keine Haftung." Aus gutem Grund, denn im November 1989 öffnete sich die Zeitung den "neuen Parteien und Organisationen", stellte ihnen mitunter fast täglich eine Seite zur Verfügung, die sie selbst gestalten konnten. Das Neue Forum, der Demokratische Aufbruch, die Vereinigte Linke, die Grüne Partei und die SPD aus Karl-Marx-Stadt, Plauen, Freiberg, Zwickau, die nicht über eigene Presseerzeugnisse verfügten, nutzten diese Gelegenheit, um unzensiert auf ihre politischen Anliegen aufmerksam zu machen - besonders im Wahlkampf vor den ersten freien Volkskammerwahlen am 18. März 1990. Dass auch die zur PDS mutierte SED eine solche Seite eingeräumt bekam, verwundert etwas, mag mit der Vergangenheit der Freien Presse zusammenhängen und mit der Interpretation, dass die PDS ja nun auch eine "neue" Partei sei und nicht mehr über ein "Bezirksorgan" verfügte.
Die Zusammenarbeit war durchaus ersprießlich, wie sich Protagonisten beider Seiten erinnern. Andreas Bochmann, anfangs Pressesprecher des Neuen Forum und gemeinsam mit Günter Saalmann und Rainer Klis (der später zur SPD wechselte) für einige dieser Seiten verantwortlich, versichert, es habe "keinerlei Berührungsängste mit dem Zentralorgan der SED gegeben". Zum einen habe man ja schon zuvor Sicherheitsgespräche mit der SED-Bezirksleitung geführt - "aus der Sorge heraus, dass der Staat gegen uns vorgeht. Die Wende war ja unabwendbar, aber das machte die Stasi auch gefährlich". Zum anderen führten die Demonstrationen mit den Rufen "freie Presse!" und "Pressefreiheit" immer am Hauptgebäude der "Freien Presse" in der Brückenstraße vorbei, und auch aus dem Haus hätten Beschäftigte der Zeitung in die Rufe eingestimmt, "wahrscheinlich Drucker", vermutet Bochmann.
Tatsächlich, erinnert sich ein Mitarbeiter der "Freien Presse", waren "mit den regelmäßig am Redaktionsgebäude vorbeiziehenden und "freie Presse" und "Pressefreiheit!" rufenden Protest-Demos und den ersten Rücktritten in der Chefredaktion die redaktionelle Atmosphäre ein Gemisch von Unbehagen und Aufbruch. Erste Redakteure stellten sich an die Spitze und übernahmen die abstrichlose Berichterstattung über die allerorts stattfindenden Kundgebungen mit ihren markigen Forderungen und den zu diesem Zeitpunkt noch 'staatsgefährdenden Äußerungen', sicherten im Veranstaltungszentrum Forum die ausführliche und nicht einfache Wiedergabe stundenlanger Debatten mit Hunderten Bürgern und Funktionären der Stadt und des Bezirkes und vertraten schließlich auch an den verschiedenen Runden Tischen im Bezirk die Zeitung, die aufgrund tatsachenverzerrender Veröffentlichungen um die Geschehnisse am 7. Oktober permanent unter heftigster Kritik stand."


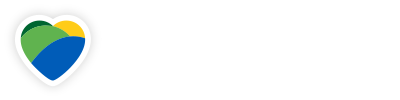
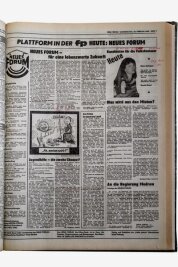

Die Diskussion wurde geschlossen.
Danke auch für diesen Artikel. Zur Wendezeit habe ich alles andere als die Freie Presse gelesen - von daher sehr interessant, etwas darüber zu erfahren.